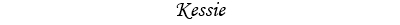|
© 2005
Zugegeben, für ein wenig verrückt hatte ich meine Schwester ja schon immer gehalten, auch wenn ich dennoch meist zu ihr aufsah. Immerhin war sie mit ihren elf Jahren zwei Jahre älter als ich und schien für mich somit fast schon erwachsen. Im vergangenen Sommer aber hatte sie sich höchst merkwürdig verhalten und oft so getan, als führte sie einen Hund an der Leine. Sie gab ihm sogar den Namen »Kessie« und rief nach ihm. Wochenlang verhielt sie sich, als gäbe es tatssächlich diesen Hund. Erst dann ließ sie diese Albernheit endlich sein. Aber sie sprach noch immer von ihrer »Kessie«. Meine Schwester wünschte sich ja nichts sehnlicher, als ein solches vierbeiniges, kaltschnäuziges Etwas in Wirklichkeit zu besitzen. Mich schauderte bei der Vorstellung. Wenn es zwei Dinge gab, die ich verabscheute und vor denen ich mich fürchtete, so waren dies Zahnärzte und Hunde. Ich erinnerte mich nicht mehr, dass ich im Alter von drei Jahren von einem Schäferhund umgeworfen worden war, der mich ansprang, um mit mir zu spielen. Erst später sollte mir meine Mutter diese Erklärung für meine Aversion geben.
Als das Weihnachtsfest näherrückte und wir gefragt wurden, was wir uns denn wünschten, antwortete meine Schwester prompt: »Na, Kessie, meinen süßen kleinen Hund möchte ich haben. Was denn sonst?« Entgegen meinen Hoffnungen war das Thema damit aber noch keineswegs vom Tisch. Wenn wir in der Vorweihnachtszeit abends beisammensaßen, Mutter eine Geschichte vorlas und wir uns am Schein der Adventskranzkerzen erfreuten, fand Maria noch so manche Gelegenheit, wieder von »Kessie« zu sprechen. Zum Glück schien aber all ihr Betteln bei unseren Eltern nichts zu nutzen. Dann kam das Weihnachtsfest. Doch irgendwie war es diesmal anders als sonst. Denn war in den Jahren zuvor Vater nachmittags mit uns zu einem Spaziergang durch den winterlich verschneiten Wald aufgebrochen, so blieben wir diesmal daheim. Und hatte Oma, die bei uns im Haus wohnte, sonst immer mit Mutter gemeinsam die Wohnung geschmückt, so nahm sie uns diesmal mit zu sich ins Souterrain. »Ich bin zu alt«, erklärte sie »Eure Eltern werden's diesmal für das Christkind richten.« Meine Schwester und ich warfen uns einen verstohlenen Blick zu. Oma wusste doch, dass wir längst nicht mehr an das Christkind glaubten. Aber gut, wenn sie meinte … Wir erwiderten nichts, und Oma schaltete den Fernseher ein. So warteten wir, dass unsere Eltern uns riefen. Dieser Ruf blieb jedoch aus, und es kam auch niemand, um uns zu holen. Was war los? Kamen unsere Eltern überhaupt mit dem Schmücken des Tannenbaums und dem Aufstellen des Krippchens zurecht? Zu gern wären wir hinaufgelaufen und hätten nachgesehen. Doch Oma hatte unser Ehrenwort, und unsere Eltern hatten es uns sogar verboten. Dann, endlich, nach Stunden, wie es schien, öffnete sich die Tür und Mutter streckte den Kopf zu uns herein. »Dann kommt mal! Aber langsam und leise!« Oh, wie strahlten der Baum und die Kerzen! Wie wunderbar hatte Vater das Krippchen mit dem winzigen Figuren der Hirten und Schafe, des heiligen Paares und des kleinen Jesuskindchens inmitten einer Krippe aus Stroh nebst Ochsen und Esel aufgebaut! Und genau unter dem prächtigen Weihnachtsbaum stand etwas. Dreifarbig. Braun, schwarz und weiß gemustert. Unbeweglich, starr. Einen Moment länger starrte ich auf dieses Etwas. Und in diesem Moment geschah es. Einen Moment lang glaubte ich noch einer Sinnestäuschung erlegen zu sein, da sah ich es wieder. Später, beim Abendessen, erfuhren wir wieso es solange gedauert hatte, bis unsere Mutter gekommen war, uns zu holen. Sie war noch mit Vater in Köln, in der Tierhandlung gewesen, Kessie rechtzeitig herbeizuschaffen. Umso übler war die Überraschung am nächsten Morgen. Meine neuen Spielsachen, die ich über Nacht auf dem Boden hatte stehen lassen, waren angeknabbert! – Wo aber war jetzt diese Bestie? »Jetzt hast du sie ja endlich wieder«, sagte ich meiner Schwester. Und mit einem Blick auf meine Spielsachen fügte ich hinzu: »Dann kann sie ja gleich wieder was von meinen Sachen fressen.« »Nein, Kessie!«, sagte meine Mutter sanft und hielt den Hund zurück. Und an mich gewandt, sagte sie: »Komm, heb's auf! Dir passiert schon nichts.« Die Messfeier dauerte mir diesmal viel zu lang. Schon während der Predigt zupfte ich am Ärmel meiner Mutter und flüsterte: »Du Mama, wann ist das hier denn endlich aus? Ich will nach Hause. Ich will zurück zu Kessie.« Von jenem Tag an war Kessie mein bester Freund. Sie begleitete mich auf meinen Streifzügen durchs Siebengebirge. Sie schlief, auch gegen das Verbot unserer Eltern, so manches Mal bei mir im Bett. Und ich hielt sie, als wir sie vierzehn Jahre später aufgrund einer schweren Erkrankung einschläfern lassen mussten. Ich werde Kessie und das Weihnachtsfest, an dem wir sie bekamen, nie vergessen.
| |
| Diese Seite wurde zuletzt am aktualisiert. Copyright © Patrick Schön. Alle Rechte vorbehalten. | |
| Impressum / Datenschutz | nach oben |