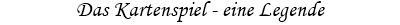|
© 2006
Alle Augen richteten sich auf Manfred, der regungslos dasaß. Sein Gesicht zeigte keine Reaktion. Nur ein einzelner Schweißtropfen trat aus dem dichten, blonden Haar heraus und lief ihm langsam über die hohe Stirn. Flüchtig wischte Manfred ihn mit dem rechten Handrücken fort, während er auf die Karten in seiner Linken sah. Drei Könige, zwei Siebener. Er hatte heute schon viel verspielt; jetzt hatte er sogar sein Haus gesetzt. Roland, der ihm gegenüber am Tisch saß, schmunzelte zufrieden. Offenbar hatte er ein besseres Blatt auf der Hand. »Na, lass schon sehen!«, sagte der. »Du hast es selbst so gewollt. Hättest ja rechtzeitig aussteigen …« Er unterbrach sich, als sie den Klang der Glocken von der Kirche her hörten, die das Weihnachtsfest einläuteten. In wenigen Minuten würde Pfarrer Lönsdorf die heilige Christmette eröffnen. Roland blickte die anderen Männer an, die bei ihnen am Tisch saßen oder dicht herangedrängt standen. Ein paar von ihnen lösten sich, um zum Gottesdienst zu gehen wie viele andere aus ihrem kleinen Dorf. Manfred registrierte es nicht. Vielleicht nahm er noch nicht einmal die Glocken wahr, so wie er dasaß und auf die Karten in seiner Hand starrte. »Was ist, Männer?«, rief der Wirt hinter dem Tresen zu ihnen herüber.»Ich will zusperren. Werdet mal fertig!« Manfred atmete hörbar auf. Als er Roland ansah, strahlten seine Augen. »Tja, ich behalte wohl mein Haus.« Mit diesen Worten zeigte er seine Karten. Full House. Da hielt ihn Manfred am Arm fest. »Moment, Fritz! Du vertraust mir doch, oder?« Roland blickte Manfred belustigt an. »Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich dir heute fünfhundert Euro abgeknöpft. Gerade hast du hundert gewonnen. Spielen wir also weiter!« Tatsächlich schien Manfred das Glück von da an gewogen. In den nächsten zwanzig Minuten gewann er beinahe all das verspielte Geld zurück. Jetzt sah auch Roland nach. »Wo kommt das Eisen her?«, fragte einer der Männer, während Roland sich wieder aufrichtete und entsetzt dreinstarrte. Roland stand auf. Er registrierte gar nicht recht, wie die anderen noch darüber debattierten, woher das Hufeisen stammen könnte, bahnte sich einen Weg und stolperte zur Tür der Wirtschaft. Manfred blickte ihm nach. Dann sah er noch einmal unter den Tisch. Noch immer lag dort das Hufeisen. Als er es berührte,spürte auch er, wie heiß es war. Er wollte Roland nachlaufen, doch als er von seinem Stuhl aufsprang und zur offenen Tür sah, erkannte er dort einen Fremden. Er stand draußen im Dunkeln, hatte die Kapuze seines Mantels gegen die Kälte und den fallenden Schnee tief in die Stirn gezogen und schaute zu ihnen herein. »Manni«, sprach ihn einer der Gefährten an und versuchte, ihn aufzuhalten. Aber Manfred ging weiter. Unwillkürlich spürte er, dass er gehen musste, dass etwas geschehen würde. Auf der Straße schlug er den Kragen seiner Jacke hoch und hob die Schultern zum Schutz gegen die Kälte an. Aus der Kirche jenseits des Dorfplatzes hörte er die meisten Einwohner des Ortes zu den Klängen der Kirchenorgel ein Weihnachtslied singen. Doch er sah niemand, auch nicht den Fremden. Wo war er hin? Wer war er? Und was wollte er? Während Manfred mit den Augen den schwach beleuchteten Platz und die abführenden Gassen absuchte, sah er ihn plötzlich wieder. Er stand in der Nähe der Kirche, am Friedhof, und winkte. Zögernd ging Manfred über das Kopfsteinpflaster, steckte die Hände dabei tief in die Hosentaschen und spürte die Kälte. Aber es war eine andere Kälte, eine unheimliche Kälte, die seine Kleidung nicht zu vertreiben vermochte, weil sie aus seinem Inneren zu kommen schien. … Oder von dem Fremden dort hinten. Manfred sah, wie die Gestalt auf den Friedhof ging. Plötzlich schien sie es recht eilig zu haben. Manfred setzte ihr nach. Was auch immer der Kerl von ihm wollte, er würde es ihm sagen müssen. Hatte er gar etwas mit diesem merkwürdigen Fund in der Wirtschaft zu tun? Jetzt machte sich Manfred keine Gedanken mehr über Gott und den Teufel, über Sünde und Christnacht. Der Kerl war ein Mensch aus Fleisch und Blut, und er wollte offenbar etwas von ihm. Manfred betrat den Friedhof. Die Gestalt war nun nur noch schemenhaft zwischen den Kreuzen und Grabsteinen im fallenden Schnee auszumachen – beinahe am anderen Ende des Geländes. Manfred lief schneller. Er stolperte, fing sich aber sogleich wieder, rutschte aus, taumelte ein paar Schritte und blieb stehen. Jetzt war auch er am Ende des Friedhofs angelangt. Jenseits des hölzernen Zauns lag das Moor. Von dem Unbekannten war weit und breit nichts zu sehen. Angestrengt blickte Manfred in die Dunkelheit. Dunklere Schatten der Bäume wechselten mit nur wenig helleren, wo ein schmaler Pfad mitten durch das Moor führte. War der Fremde etwa geradewegs in das Sumpfgebiet gelaufen? Kannte er sich denn in dieser Gegend aus, oder würde er einen qualvollen Tod sterben, wenn er im Morast einsackte, sein Körper immer tiefer in diese dicke Flüssigkeit einsank, die ihm bald bis zur Taille stand, und er dann noch mehr hineingeriet, schließlich bis zum Hals, wenn auch sein Kopf versank und zum Schluss nur noch seine Arme herausragten, noch immer verzweifelt und vergeblich bemüht, irgendwo Halt zu finden, das Unvermeidliche abzuwenden? Manfred erschauderte. Auch diesmal war es nicht die Kälte des Winters. Vielmehr erinnerte er sich an seine Jugend, als er und sein Freund Werner hier gewesen waren. Wie Werner plötzlich versehentlich einen Fuß neben den festen Boden des schmalen Pfades gesetzt hatte, wie er versuchte, ihn wieder herauszubekommen … und wie er, Manfred, den Freund schließlich hineingestoßen hatte in den Sumpf. Oh Gott! Warum hatte Werner auch ausgerechnet Marie lieben müssen, an die Manfred sein Herz verschenkt hatte? Ja, Manfred wusste plötzlich, woher diese eisige Kälte kam. Sie kam nicht vom Schnee, nicht von den Lufttemperaturen und auch nicht von der fremden Gestalt. Sie kam direkt aus ihm, aus den Tiefen seiner Seele: Er war ein Mörder. Und ein Lump. Und ein Sünder, der lieber Karten spielte, anstatt wenigstens in der Christnacht in die Kirche zu gehen und Gott um Verzeihung zu bitten. »Du Mörder«, hörte er plötzlich eine Stimme sagen. »Du elender Mörder! Heute ist die Nacht, da Christus geboren wurde, um die Welt zu erlösen. Du aber, Manfred Müller, hast keine Erlösung verdient. Für dich und deinesgleichen ist Gott umsonst Mensch geworden, hat gelebt und ist gekreuzigt worden. Für dich und deinesgleichen ist die Weihnacht vergeblich. Du hast Gottes Segen verspielt, du Unglückseliger.« Am Morgen des Neujahrstags fand man den Leichnam des seit Weihnachten vermissten Manfred Müller im Moor. Sein Oberkörper steckte im Schlamm des Sumpfes, nur die Beine lagen auf dem schmalen, sicheren Pfad. Als man sich bemühte, die sterbliche Hülle herauszuziehen, und das Moor sein Opfer schließlich freigab, stellte man fest, dass Manfred mit der linken Hand eine weitere Leiche umklammert hielt: den seit Jahren vermissten Werner Odenthal. Seine Leiche war, trotz der vielen Jahre, auf wundersame Weise recht gut erhalten, sodass man ihn rasch identifizieren konnte. Was die näheren Umstände von Manfreds Tod betrifft, so herrschen bis zum heutigen Tag Unsicherheit und Zweifel. Ebenso bezüglich des Auffindens von Odenthal durch seinen alten Freund. Über den merkwürdigen Fremden, der in jener Nacht aufgetaucht war, sprach niemand offen. Die, die ihn gesehen hatten, behielten es für sich aus Angst unter den strengen Katholiken im Ort geschmäht zu werden. Zudem glaubten sie, es wäre der Teufel selbst gewesen; immerhin hatte man dieses seltsame Hufeisen gefunden. Manfred jedoch hatte sein Leben verwirkt, indem er Werner seinerzeit tötete, anstatt ihm zu helfen. Ein altes Sprichwort lautet, dass der Mensch seines eigenen Glückes Schmied sei. Und in gewisser Weise galt dies auch für Manfred Müller. Er hatte das Glück in der Weihnachtsnacht herausgefordert und letztlich alles verloren. So oder ähnlich heißt es zumindest in der Legende.
| |
| Diese Seite wurde zuletzt am aktualisiert. Copyright © Patrick Schön. Alle Rechte vorbehalten. | |
| Impressum / Datenschutz | nach oben |